
Friedhof in St. Ives, Cornwall
Gabriel Urbain Fauré (1845–1924)
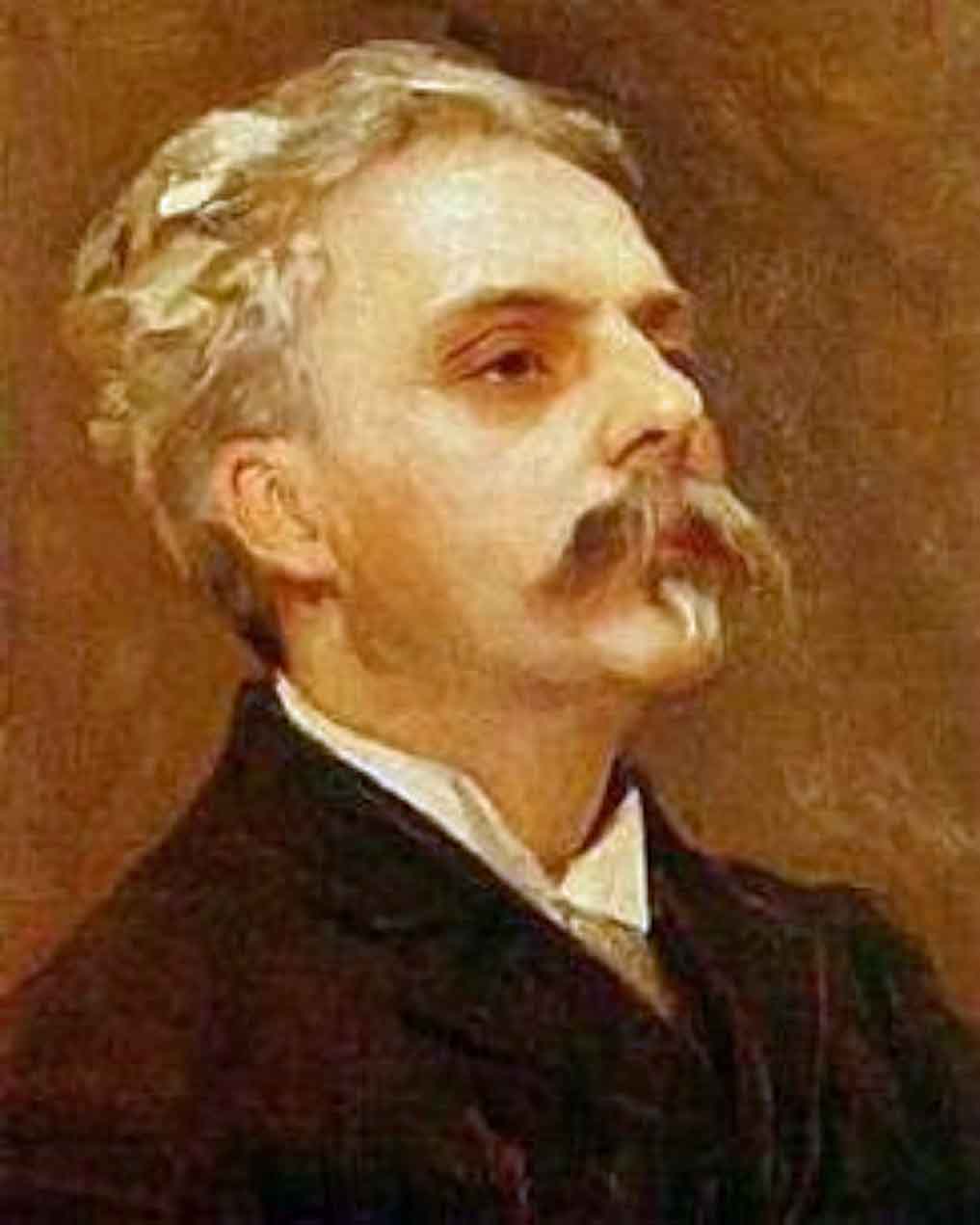
Porträt von Gabriel Fauré, in Öl gemalt von John Singer Sargent, um 1889 (Museum für Musik, Paris)
Der französische Komponist Gabriel Fauré kam 1845 im südfranzösischen Paniers (zwischen Toulouse und den Pyrenäen) als Sohn eines Schulleiters zur Welt. Bereits als Fünfjähriger verbrachte Fauré viel Zeit in der neben seinem Elternhaus gelegenen Kirche am Harmonium. Da in der Schule des Vaters auch Musik unterrichtet wurde, konnte Faurés Begabung ganz natürlich gefördert werden. Mit 8 Jahren spielte er so gut Klavier, dass Besucher den Eltern rieten, die Begabung Ihres Sohnes ernst zu nehmen. Der Vater folgte dem Rat und meldete seinen Sohn 1854 – also mit 9 Jahren – an der Schule für Kirchenmusik in Paris an. 1861 – inzwischen 16-jährig wurde Fauré nicht nur Klavierschüler des nur zehn Jahre älteren Camille Saint-Saëns, sondern er bekam durch ihn auch Einblicke in die Kompositionstechnik der deutschen Komponisten Mendelsohn, Schumann, Wagner und Liszt.
Nach Abschluss seiner Studien avancierte er zu einem der führenden Organisten der Stadt. 1877 wurde Fauré zum maître de chapelle (Chorleiter) der Eglise de la Madeleine gewählt. Aber das Prestige, das diese Anstellung mit sich brachte, stand in einem beklagenswerten Widerspruch zu der schlechten Besoldung. Viele Stunden, in denen er lieber komponiert hätte, musste er dafür aufwenden, bei Gesangsvereinen als Begleiter zu fungieren oder Klavierunterricht zu erteilen. Und so führte Fauré ein Doppelleben. Am Morgen fand er sich zu den Chorproben in der Kirche St. Madeleine ein. Nachmittags eilte er durch die Stadt und besuchte seine Privatschüler. Am Abend aber versuchte er in den Pariser Salons seinen anstrengenden Alltag zu vergessen. Für die illustre Gesellschaft der aristokratischen Mäzene wurde er mit seiner attraktiven Erscheinung und seinen glänzenden Improvisationen am Klavier schnell zu einem gern gesehenen, bewunderten Gast.
1896 verbesserte sich für den inzwischen 51-jährigen Fauré die finanzielle Situation erheblich, denn er wurde Titularorganist an St. Madleine in Paris und gleichzeitig nahm er einen Ruf als Professor für Kompositionslehre an das Pariser Conservatoire an, als Nachfolger des Komponisten Massenet. Unter seinen bedeutenden Schülern waren dort Maurice Ravel und Nadia Boulanger. Durch seine lange Lehrtätigkeit nahm Fauré maßgeblich Einfluss auf die Musik in Frankreich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Zwischen 1905 und 1920 leitete er als Direktor das Konservatorium. Er modernisierte den Lehrplan für die Studenten und wurde deshalb manchmal als „Robespierre“ (= radikaler Revolutionär in der Französischen Revolution) beschimpft. So setzte er z.B. durch, dass sich seine Studenten in intensiven Studien mit dem Werk von Richard Wagner befassen durften. Leider machten sich in dieser Zeit erste Anzeichen einer Hörstörung bemerkbar: Fauré litt an einer Erkrankung des Innenohrs, die zu einer sich ständig verschlimmernden Schwerhörigkeit führte.
 Requiem op. 48
Requiem op. 48
Das Requiem op. 48 von Fauré ist eine Komposition für zwei Solisten (Sopran und Bariton), vier- bis sechsstimmigen Chor, Streichorchester (ohne die hellen Stimmen der Violinen), Harfe, Pauke und Orgel. An der Besetzung erkennt man, dass Fauré die ihm zur Verfügung stehenden instrumentalen und vokalen Mittel – im Gegensatz zu dem fünfzig Jahre zuvor entstandenen pompösen Requiem seines Landsmannes Hector Berlioz – ganz und gar unspektakulär einsetzt. Er wollte einen gedämpften Orchesterklang mit dunklem Timbre und bevorzugte deshalb die tiefen Streicher: Bratschen und Celli sind immer geteilt; die Violinen treten, wenn überhaupt, ohne jeden sich vordrängenden Glanz in Erscheinung. Die Pauke ist nur im sechsten Satz, im „Libera me“ zu hören; ein Hervortreten der Bläser wird zum Ereignis und ein Forte des Chores zum Glanzpunkt.
Die erste Fassung des Requiems schrieb Fauré – 42 jährig – 1887/88. Man geht sicher nicht fehl in der Annahme, dass das Requiem wohl in der Trauer um den Verlust von Faurés Vaters (1885) und seiner Mutter (1887) entstand. – Wir singen die vom Komponisten bearbeitete Fassung aus dem Jahre 1900.
Fauré komponierte fünf Sätze:
- Introït (Introitus) et (und) Kyrie,
- Sanctus,
- Pie Jesu,
- Agnus Dei
- In Paradisum
Aufgeführt wurde das Requiem erstmals am 16. Januar 1888 in der Pariser Kirche St. Madeleine zur Beerdigung des angesehenen Architekten Joseph Lesoufaché.
Weil Fauré mit der Erstfassung des Werkes noch nicht zufrieden war, setzte er die Arbeit an seinem Requiem fort: So fügte er der Besetzung der Erstfassung zunächst Hörner und Trompeten hinzu, bearbeitete es von 1889 bis 1892 für Kammerorchester und ergänzte es um das Offertoire und das Libera Me von 1877. Diese Fassung wurde am 23. Januar 1893 uraufgeführt. In den Jahren 1894 bis 1899 gab Fauré seinem Requiem die am 12. Januar 1900 uraufgeführte, siebensätzige Endfassung für großes Orchester.
| Introïte (Introitus) et (und) Kyrie |
Chor | |
| Offertoire |
Bariton Solo, Chor | |
| Sanctus |
Chor | |
| Pie Jesu |
Sopran Solo | |
| Agnus Dei | Chor | |
| Libera me |
Bariton Solo, Chor | |
| In Paradisum | Chor |
Das Requiem von Fauré unterscheidet sich von vielen Vertonungen vor ihm: In vielen Vertonungen der lateinischen Totenmesse bildete bis dahin die Sequenz „Dies Irae“, einen Höhepunkt, wenn nicht das Zentrum des ganzen Werkes. Fauré dagegen verzichtet in seinem Requiem auf eine dramatisierende Darstellung des Dies irae und damit auf die Angst und Schrecken erweckenden Bilder des Textes vom Strafgericht und den Androhungen der Höllenqualen. Stattdessen schuf Fauré eine friedvolle Vision des Jenseits von stiller Zuversicht und ewiger Ruhe – die nicht durch einen einzigen Paukenschlag oder Trompetenstoß „gestört“ wird -, in die eben nur der letzte Vers der Sequenz Pie Jesu, Domine, dona eis sempiternam requiem (Gütiger Jesus, Herr gib ihnen die ewige Ruhe) hinein passte. Fauré beschließt sein Werk mit einer nur selten vertonten Antiphon aus der Totenliturgie.
In paradisum (In das Paradies mögen Engel dich begleiten…). Dieser Text wird traditionell vor der Überführung des Leichnams von der Kapelle zum Grab gesprochen. Fauré – ein Agnostiker – hat die die Vorstellung vom Paradies als einen Ort der Erquickung, des Lichts und des Friedens, immer wieder als Organist in Lesungen gehört. ist. Und genau diese Zukunft wünscht er sich für von ihm geliebte Menschen und bezieht sich damit auch auf die Grundbedeutung des Wortes Requies (Ruhe).
Die zurückhaltende Ruhe, die Faurés Requiem ausstrahlt, ist Ausdruck eines illusionslosen, aber selbstbewussten und vertrauensvollen Menschen. Auf den Einwand, dass sein Requiem eher einem Wiegenlied, denn einer Klage gleiche, erwiderte Fauré, dass dieses genau seiner Sicht des Todes entspreche, der nämlich kein qualvoller Übergang sei, sondern „eine glückhafte Befreiung, ein Sehnen nach dem Glück der anderen Welt“.
 Der erste Satz, Introït,
Der erste Satz, Introït,  beginnt in zurückhaltender Dynamik (pianissimo = sehr leise) mit einem statisch wirkenden Chorsatz. Über dem unisono spielenden Orchester intoniert der Chor auf einem sanft gesungenen Akkord die zentrale Aussage des Werkes Requiem aeternam dona eis requiem (=Herr, gib ihnen die ewige Ruhe). Eine dynamische Steigerung hebt dann den Text et lux perpetua luceeat (= und das ewige Licht möge ihnen leuchten) hervor. Die dreifache, immer leiser werdende Wiederholung des Wortes luceat hebt die Bedeutung des Wortes hervor. Die Tenöre und danach die Soprane greifen den Anfangstext auf und führen ihn melodiöser weiter. Lautstark (fortissimo = sehr laut) trägt danach der Chor die Bitte Exaudi orationem mea (= erhöre mein Gebet) vor. Der letzte Teil des Satzes ist die Vertonung des Kyrie Rufes. Während der Chor die ersten Rufe sehr leise, sanft und ausdruckstark intoniert, wirken die ersten Christe-Rufe durch die große Lautstärke (fortissimo) sehr eindringlich. Sehr leise und zurückhaltend klingt Satz sanft mit dem Kyrie eleison aus. Fauré gelingt hier eine sehr eindrucksvolle Schlussgestaltung des Satzes.
beginnt in zurückhaltender Dynamik (pianissimo = sehr leise) mit einem statisch wirkenden Chorsatz. Über dem unisono spielenden Orchester intoniert der Chor auf einem sanft gesungenen Akkord die zentrale Aussage des Werkes Requiem aeternam dona eis requiem (=Herr, gib ihnen die ewige Ruhe). Eine dynamische Steigerung hebt dann den Text et lux perpetua luceeat (= und das ewige Licht möge ihnen leuchten) hervor. Die dreifache, immer leiser werdende Wiederholung des Wortes luceat hebt die Bedeutung des Wortes hervor. Die Tenöre und danach die Soprane greifen den Anfangstext auf und führen ihn melodiöser weiter. Lautstark (fortissimo = sehr laut) trägt danach der Chor die Bitte Exaudi orationem mea (= erhöre mein Gebet) vor. Der letzte Teil des Satzes ist die Vertonung des Kyrie Rufes. Während der Chor die ersten Rufe sehr leise, sanft und ausdruckstark intoniert, wirken die ersten Christe-Rufe durch die große Lautstärke (fortissimo) sehr eindringlich. Sehr leise und zurückhaltend klingt Satz sanft mit dem Kyrie eleison aus. Fauré gelingt hier eine sehr eindrucksvolle Schlussgestaltung des Satzes.
Der zweite Satz, das Offertoire, beginnt in sehr langsamem Tempo mit einer instrumentalen Einleitung. Sehr leise, weich und flehentlich zwei Chorstimmen (Alt und Tenor) Jesus an (O Domine Jesu Christe) und trage ihre Bitte vor. Im Mittelteil des Satzes trägt der Bariton in etwas schnellerem Tempo die eigentlichen Fürbitten solistisch vor. Im Schlussteil, der das Anfangstempo wieder aufgreift, trägt der Chor zunächst sehr leise, dann aber immer lauter werdend beschwörend seine Worte aus dem Anfangsteil wieder vor, ehe er sehr, sehr leise (ppp) mit dem Wort „Amen“ den Satz beendet.
Der dritte Satz, das Sanctus, drückt eine unendliche Ruhe aus. Zu den sehr leise spielenden Instrumenten hat Fauré einen unisono (einstimmig) angelegten Chorsatz geschrieben. Die sanfte Stimmung wird kurz unterbrochen von markant gesungenen Hosanna in excelsis-Rufen des Chores, die wirkungsvoll von Bläsern unterstützt werden. Mit dem sehr leise und in langen Notenwerten gesungenen Wort Sanctus kehrt im sanften Ausklingen des Satzes die unendlich wirkende Ruhe wieder zurück.
Der vierte Satz, das Pie Jesu (= Milder Jesus), ist wohl der bekannteste und beliebteste Satz des Requiems. Fauré hat – wie ich oben ausgeführt habe – bewusst auf die Vertonung der gesamten Dies irae-Sequenz verzichtet. Nur den letzten Vers der Sequenz, das Pie Jesu, der inhaltlich zu seiner Konzeption passte, hat er vertont. Die nachdrückliche Bitte um ewige Ruhe wird mehrfach vorgetragen von einer Solistin (Sopran) mit einer schlichten, lieblichen Melodie.
Die ruhige Stimmung des letzten Satzes bleibt im fünften Satz, dem Agnus Dei, das die Tenöre leise, weich und ausdrucksvoll beginnen, zunächst erhalten, bis dann mit der Bitte des gesamten Chores um das Geschenk ewiger Ruhe das musikalische Geschehen intensiver und beschwörender wird.
Den sechsten Satz, das Libera Me, hat Fauré vor den anderen Teilen vollendet. Der Satz ragt stilistisch etwas aus dem Rahmen der Gesamtkomposition, da er in seinem Gestus eher hymnische Züge – einmal auch dramatische – in sich trägt und manchmal an Verdi erinnert.
Zu Beginn fleht der Solo-Bariton Gott sehr ruhig an mit der Bitte um Erlösung vom ewigen Tod. Bei der Textstelle, an welcher der Bariton davon singt, dass Gott kommen wird, die Erde mit Feuer zu richten (dum veneris judicare saeculum per ignem), verändert sich die ruhige Stimmung des Satzes: Mit Hilfe der Parameter Tonstärke, Tondauer und Harmonik hat Fauré die innere Erregung, die den Menschen bei dieser Vorstellung ergreift, musikalisch deutlich gemacht. Der nun einsetzende Chor malt in eindringlichem Gesang das Zittern (tremens) und die Furcht (timeo) der Menschen nach.
Und dann kommt doch noch Dramatik in diese Requiem-Komposition: Unvermittelt leiten die Hörner einen wahren Aufschrei ein, mit dem der Chor im Fortissimo auf das Jüngste Gericht (dies illa) hinweist. Doch bevor sich ein Gefühl von Angst und Schrecken ausbreiten kann, kehrt der Chor nach nur siebzehn Takten wieder zum Eingangsthema (Requiem aeternam) zurück und lässt diesen Abschnitt des Satzes sehr leise, sehr sanft und mit sehr langen Tondauern, die die Worte luceat eis sehr deutlich hervorheben – und damit die Bitte, Gott möge für die Toten das ewige Licht leuchten lassen -, zu Ende gehen. Fauré gelingt es an dieser Stelle ein so starkes Gefühl von Frieden und Zuversicht zu vermitteln, als wenn die 17 Takte mit der Thematik das „Jüngste Gericht“ (dies illa) nie stattgefunden hätten.
Für den siebten Satz – In Paradisum – hat Fauré nur eine kleine orchestrale Besetzung vorgesehen. Auffällig sind in diesem Satz die schillernd stehenden, hellen Klängen (Harfe). Der „engelhafte“ Gesang – unterstützt von Orgel-und Harfenarpeggien – scheint die Seelen der Verstorbenen direkt ins Paradies zu führen. Gerade dieser letzte Satz macht deutlich, was Fauré meint, wenn er sagt, dass der Tod „nicht ein schmerzliches Erlebnis, sondern eine willkommene Befreiung, ein Streben nach dem Jenseits ist“.
Bruno Bechthold
Francis Poulenc, (1899 – 1963)
Gloria
 Francis Poulenc, der am 7. Januar 1899 in Paris geboren wurde, wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf, denn sein Vater war Teilhaber der Arzneimittelfirma Rhone-Poulenc-Rôre. Seine Mutter war nicht nur künstlerisch vielseitig interessiert, sondern auch eine begabte Pianistin. Sie war es auch, die sein musikalisches Talent entdeckte und ihm den ersten Klavierunterricht erteilte.
Francis Poulenc, der am 7. Januar 1899 in Paris geboren wurde, wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf, denn sein Vater war Teilhaber der Arzneimittelfirma Rhone-Poulenc-Rôre. Seine Mutter war nicht nur künstlerisch vielseitig interessiert, sondern auch eine begabte Pianistin. Sie war es auch, die sein musikalisches Talent entdeckte und ihm den ersten Klavierunterricht erteilte.
1914 – im Alter von 15 Jahren – wurde Poulenc Klavierschüler des damals sehr bekannten spanischen Pianisten Ricardo Viñes (Freund der Komponisten Debussy und Ravel). Er wurde ein ausgezeichneter Pianist und Liedbegleiter. Seine im Selbststudium erworbenen Kenntnisse im Bereich der Musiktheorie vertiefte Poulenc durch professionellen Unterricht u. a bei Maurice Ravel. 1917 versuchte er erfolglos sich als Student an das Pariser Konservatorium einzuschreiben, denn trotz guter Vorbereitung (s.o.) bestand er die Aufnahmeprüfung nicht. Das warf ihn allerdings nicht aus der Bahn und er komponierte zunächst nach Regeln und Vorstellungen, die er für richtig befand. Von 1921 bis 1924 nahm er dann aber doch bei dem ehemaligen Fauré-Schüler Charles Koechlin Kompositionsunterricht.
Zunächst blieb Poulenc die Anerkennung als seriöser Komponist versagt und es eilte ihm lange Zeit der Ruf eines „Amateurs“ voraus. So bezeichneten Kritiker seine musikalische Sprache als zu einfach und zu direkt. All das war sicher darauf zurückzuführen, dass Poulenc die Aufnahmeprüfung nicht bestanden hatte.
Poulenc selbst empfand später gerade den Umstand, nicht zu den Studierten des Konservatoriums gehört zu haben, eher als Vorteil. Noch zu einer Zeit, als er schon lange als bedeutender Komponist anerkannt war, erklärte er zu seiner Kompositionsweise, dass er instinktiv arbeite, nicht nach festgelegten Regeln, und er stolz darauf sei, kein starres, festes System zu besitzen.
Nach dem ersten Weltkrieg wurde Poulenc ein Mitglied der berühmten „Groupe des Six“ (u.a. Arthur Honegger, Erik Satie). Als intellektueller Kopf der Gruppe fungierte der Schriftsteller Jean Cocteau, der das Programm der Gruppe so formulierte: „Schluss mit den Wolken, Wogen, Aquarien, den Undinen und nächtlichen Düften – was wir brauchen ist Musik, die auf der Erde zu Hause ist, eine Musik für alle Tage … vollendet, rein, ohne überflüssiges Ornament …“. Cocteaus Idee von einer unterhaltsamen Musik hat sicher Poulenc mit der größten Konsequenz verwirklichte, denn Klarheit (Clarté), spielerischer geistreicher Umgang mit musikalischen Vorbildern aus Jazz, Varieté und Zirkus, vor allem aber der „ernsten” Musikliteratur zeichnen viele seine Werke aus. Begonnen hatte Poulenc in den 20er Jahren mit der Komposition von Zirkus- und Ballettmusik; allerdings konnte er zunächst noch nicht vom Komponieren alleine leben. Aber schon mit 28 Jahren (1927) brauchte er sich keine Sorgen mehr um seine finanzielle Situation machen, denn er wurde durch eine große Erbschaft sehr vermögend. Noch im gleichen Jahre kaufte er sich bei Noizay im Loiretal ein Landhaus, das für Poulenc nicht nur ein Ruhepunkt wurde, an den er sich häufig zurückzog, sondern auch der Ort wurde, an dem der größte Teil seiner weiteren Kompositionen entstand.
Poulenc, der ein eher distanziertes Verhältnis zur Kirche pflegte und sie nach dem Tod seines erzkatholischen Vaters 1917 sogar verließ, hegte darum lange Zeit keinerlei Interesse, Chor- und Kirchenmusik zu komponieren. Dies änderte sich schlagartig im Jahre 1936 mit dem Unfalltod seines Freundes Pierre-Octave Ferroud, eines Komponisten und Förderers zeitgenössischer Musik. Die Nachricht vom Tod seines Freundes erreichte Poulenc während eines Urlaubs in Frankreich; sie erschütterte ihn so sehr, dass er sich zu einer Wallfahrt nach dem nahe gelegenen Rocamadour zur berühmten Statue der „Vierge Noire“, (Schwarzen Madonna), entschloss. Die Erfahrungen dort berührten ihn so tief, dass sie eine neue Annäherung an den katholischen Glauben einleiteten und den Grundstein für eine nachhaltige und fruchtbare Auseinandersetzung mit sakraler Chormusik legten.
Schon ein Jahr (1937) später komponierte er eine Messe für A-cappella-Chor zum Andenken an seinen Vater und in der Folgezeit weitere Vertonungen geistlicher Motetten und Gebete.
Kurz vor seinem Tod im Jahre 1963 äußerte sich Poulenc zum Stellenwert der Chormusik innerhalb seines Gesamtwerkes: „Ich glaube, ich habe den besten und glaubwürdigsten Aspekt meiner selbst in meine Chormusik eingebracht. Nehmen Sie mir meine Unbescheidenheit nicht übel, aber ich habe das Gefühl, auf diesem Gebiet wahrhaftig etwas Neues beigetragen zu haben, und ich möchte fast annehmen, dass man sich in fünfzig Jahren, wenn dann überhaupt noch jemandem an meiner Musik gelegen ist, eher für das Stabat Mater als für die Mouvements perpétuels interessieren wird.“
Gloria
für Sopran, Chor und Orchester (1959)
„Jetzt ist es nötig, sich auf das Gloria zu richten. Genug Schmerz, genug Leidenschaft! Zugegeben, vom Stabat Mater an bis zur Voix Humaine war das Leben nicht zum Lachen, aber ich denke, dass all die schmerzlichen Erfahrungen zu meiner Bewährung nötig waren. Jetzt ist es genug, Friede! … Friede!“
Poulenc spielt in diesem Brief vom Juni 1959 an Simone Girard auf die Verluste aus seinem Freundeskreis in den vergangenen zehn Jahren an. Dabei dachte er neben anderen z. B. an den Geiger Jacques Thibaud, an den Dichter Paul Eluard, an den Komponisten Arthur Honegger und ganz sicher an seinen Partner Julien Roubert.
Die halbstündige „Chorsinfonie“ – wie Poulenc das Werk selbst nannte – aus den Jahren 1959/60 ist ein überaus abwechslungsreiches Werk für Sinfonieorchester, Solostimme (Sopran) und vierstimmigen Chor. Poulenc hat den Text des Gloria entsprechend der Sinnabschnitte in sechs Sätze eingeteilt.
Die unbeschwerte Fröhlichkeit, die das Werk über weite Strecken verbreitet, hat mit der Glaubensauffassung Poulencs zu tun. Er selbst führte diese Glaubensauffassung auf die Herkunft des Vaters aus dem französischen Süden zurück: „…die romanische Kunst, und besonders diejenige aus Frankreichs Süden, war immer mein religiöses Ideal. … Ich möchte, daß sich der religiöse Geist offen an der Sonne ausdrückt, mit dem Realismus, den wir an den romanischen Kapitellen sehen. Mein Vater, wie seine ganze Familie, war tief, aber unbefangen religiös, ohne die geringste Kargheit.“
Den ersten Satz – Gloria eröffnet majestätisch (Maestoso), sehr laut, in klarem G-Dur und mit einem mächtigen Akkordmotiv in punktiertem Rhythmus das Orchester (deutliche Dominanz der Blechbläser). Bevor der Chor einsetzt, führen die Holzbläser in einer Modulation weg von G-Dur hin zu h-Moll. Der Bass greift dann nicht nur die Tonart Hm, sondern auch den punktierten Rhythmus der Einleitung auf und deklamiert sehr akzentuiert den Text Gloria in excelsis deo (Ehre sei Gott in der Höhe). Durch das Hinzutreten von Tenor, Alt und Sopran entwickelt sich der Gesang hin zu einem vierstimmigen Chorsatz. Am Ende des Satzes bewegen sich Chor und Orchester wieder in der Anfangstonart G-Dur. Deklamation, Tempo und Charakter des Satzes zeigen eine Nähe zu Strawinskys Psalmensinfonie.
Der zweite, in C-Dur geschriebene äußerst lebhafte, sehr laut (ff ) einsetzende Satz Laudamus te (Wir loben dich) bildet einen deutlichen Kontrast zum ersten, eher verinnerlichten Satz, denn eingängige Wechselgesänge, flammende Orchesterfarben und mitreißende Tanzrhythmen verleihen dem gesamten Stück Temperament und Leidenschaft.
Mit den vom Chor intonierten melodischen Floskeln und den meditativ wirkenden, zart begleitenden Orchesterakkorden erinnert der kurze Mittelteil Gratias agimus (Dank sagen wir) nicht nur an gregorianische Gesänge, sondern er bildet auch einen Ruhepunkt im sonstigen Wirbel des Satzes.
Dass dieser Satz bei der französischen Erstaufführung wegen der nicht religiös wirkenden Tanzrhythmen für einen Skandal sorgte, verstand Poulenc nicht. „Ich dachte beim Komponieren lediglich an die Renaissance-Fresken Benozzo Gozzolis, auf denen Engel die Zunge herausstrecken, und an jene ernsten Benediktinermönche, die ich eines Tages beim Fußballspiel gesehen habe.” (s. dazu o. Ausführungen zur Glaubensauffassung Poulencs).
Der dritte, sehr langsam und leise (p) einsetzende Satz Dominus Deus (Herr Gott) vermittelt Poulencs aufrichtige und tiefe Religiosität. Die Holzbläser, die in diesem Satz den Orchestersatz deutlich dominieren, führen mit ihrer Einleitung in die Stimmung des Satzes ein. Dann setzt die Solistin (Sopran) mit einer äußerst dramatischen Melodielinie, die von jeweils zweitaktigen Motiven gebildet wird, ein. Zurückhaltend in der Tonstärke setzt der Chor ein, dessen Part auch überwiegend aus zweitaktigen Motiven besteht. Die hier von Poulenc geforderte homogene Pianokultur des Chores im Zusammenwirken mit der dramatisch klingenden, klanglich den Chor überhöhenden Sopranstimme und dazu der Instrumentation mit überwiegend spielenden Holzbläsern führt zu einem besonderen Klangerlebnis, dass, wenn es gelingt, nur als beglückend bezeichnet werden kann.
Der vierte Satz – Domine fili unigenite (Herr Gott, eingeborener Sohn) – ist der kürzeste der sechs Sätze und ähnelt in seinem Ausdruck dem zweiten Satz. Auffällig Merkmale sind das schnelle Tempo und die mitreißenden Rhythmen die dem Ganzen den Eindruck eines wirbelnden Tanzes vermitteln. Die sich oft wiederholenden Melodien basieren auf pentatonischen Modellen.
Im fünften Satz Dominus Deus, Angus Dei (Herr Gott, Lamm Gottes) erinnert Vieles an den dritten Satz: Das Tempo (sehr langsam), der Einsatz der Solistin (Sopran), die Einleitung durch die Holzbläser. Die Musik klingt dunkel. Beim Einsatz der Solistin fallen mit der übermäßigen Quarte und einer übermäßigen Quinte zwei ungewöhnliche Intervalle ins Ohr, die ebenso wie die Tonartwechsel zu einer geheimnisvollen Stimmung führen.
Der sechste Satz Qui sedes ad dexteram Patris (Der du sitzest zur Rechten des Vaters) wird in ruhigem Tempo eingeleitet von feierlichen Einwürfen des a cappella singen Chores im Wechsel mit Einwürfen des Orchesters. Dabei erinnert der erste Einwurf des Orchesters an das punktierte Fanfarenmotiv aus dem ersten Satz.
Nach der Einleitung ändert sich das Tempo (Allegretto) und das Spiel des Orchesters: Bestimmend sind die kurzen Notenwerte der hohen Streicher (Sechzehntel) und die aus dem Jazz entlehnte Spielfigur der tiefen Streicher (Walking Bass).
Den letzten Abschnitt des Satzes überschreibt Poulenc mit Extraordinairement calme (= außerordentlich ruhig). Völlig unbegleitet intoniert die Solistin zweimal klar und sehr laut das Wort „Amen“. Der Chor greift es auf, führt aber wieder zum Text zurück. Am Ende kombiniert Poulenc das vom Chor überaus laut (fff) gesungene Amen mit dem Fanfarenmotiv aus dem ersten Satz, was der Stelle einen ausgesprochen triumphierenden Charakter verleiht. Das letzte Amen erklingt überaus leise (ppp), zuerst vom Chor, dann von der Solistin intoniert. Der Ton d der Sängerin passt dabei zu beiden (bitonal) lang gespielten Akkorden des Orchesters (Hm / G).
Betrachtet man das Gloria von Poulenc abschließend, lässt sich konstatieren, dass der „Mönch“ (le moine) Poulenc und der „Lausbube“ (le voyou) in diesem Werk in vollendeter Seligkeit leben.
Bruno Bechthold
Wir führen das Fauré-Requiem und das Gloria von Poulenc auf am
Mittwoch, dem 20.11.2013
um 19:30 Uhr in der Marktkirche Paderborn
Nordwestdeutsche Philharmonie,
Städtischer Musikverein und Partnerchöre,
Esther Dierkes – Sopran,
Björn Bürger – Bariton,
Gesamtleitung: Matthias Hellmons
Konzertkritik:
Wir bedanken uns bei der Rezensentin Andrea Auffenberg, dem Fotografen Jörn Hannemann und der Redaktion des „Westfalen-Blattes“ für die Konzertkritik und die Genehmigung zur Veröffentlichung an dieser Stelle.
Wir bedanken uns beim Rezensenten und Fotografen Gunther Gensch und der Redaktion der „Neuen Westfälischen“ für die Konzertkritik und die Genehmigung zur Veröffentlichung an dieser Stelle.

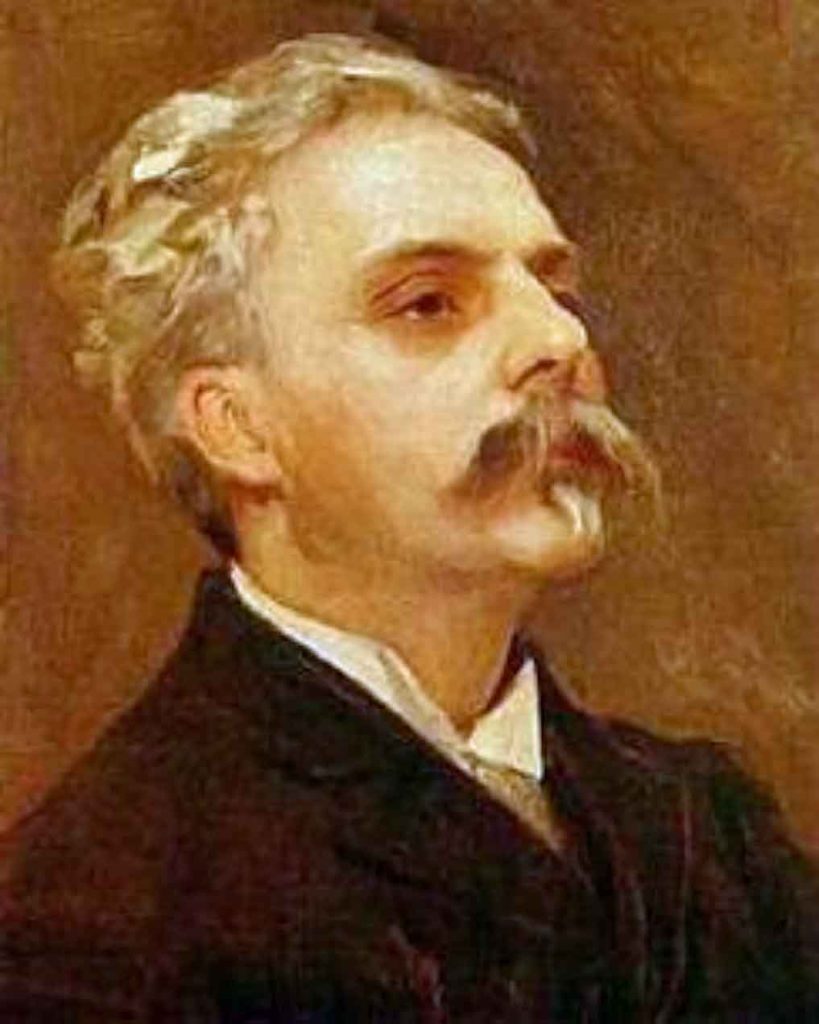



Der Solist Björn Bürger gewann bereits mit 16 Jahren den Kulturförderpreis seiner Heimatstadt Rodgau für sein künstlerisches Wirken in den Bereichen Gesang, Theater und Klavier. Seit dieser Spielzeit 2013 ist er festes Ensemblemitglied der Oper Frankfurt. In 2012 gewann er den ersten Preis im Bundes-Wettberb Gesang und ist Erster Preisträger des Anneliese-Rothenberger Wettbewerbs 2013.